
In unserem Rechts-Newsletter sammeln wir für Sie aktuelle Urteile und juristische Fälle. Sie haben noch Fragen zu Arbeitsrecht, Berufsrecht oder einem Vertrag? Ich berate Sie gern.
Dürfen Sie Ihre Rezepte stempeln statt unterschreiben?
Ärzte müssen alle Verordnungen persönlich unterschreiben – von Hand oder digital. Die Verwendung eines Stempels ist nicht zulässig.
Das hat das Bundessozialgericht am 27.08.2025 (Az.: B 6 KA 9/24 R9) bestätigt. Zu entscheiden war zunächst über 487.000 Euro für die Quartale I/2015 bis II/2018. Zusammen mit weiteren noch anhängigen Verfahren kommen auf den Arzt Rückforderungen von 1,24 Millionen Euro zu.
So kam es zur Entscheidung
Ein Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie unterzeichnete in den Quartalen 1/2015 bis 2/2018 seine Verordnungen für Sprechstundenbedarf nicht persönlich. Stattdessen nutzte er einen Unterschriftenstempel (Faksimilestempel). Auf Antrag einer Krankenkasse setzte die Prüfungsstelle deshalb einen Regress in Höhe von rund 490.000 Euro fest.
Widerspruch und Klage des Arztes waren erfolglos. Das Sozialgericht begründete die Festsetzung des sonstigen Schadens mit § 48 Absatz 1 Bundesmantelvertrag-Ärzte. Auch wenn formal keine Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 SGB V vorliege, handele es sich bei einem Schaden, der im Zusammenhang mit der Ausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit entstehe, um eine Frage der wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten. Der Arzt habe seine vertragsärztlichen Pflichten verletzt, da er die Verordnungen nicht persönlich unterzeichnet habe. Diese Pflichtverletzung sei auch schuldhaft, mindestens fahrlässig erfolgt.
Der Krankenkasse sei ein normativer Schaden entstanden. Ob alle Verordnungen medizinisch indiziert gewesen seien, spiele keine Rolle: Die Feststellung eines sonstigen Schadens verstoße weder gegen Treu und Glauben noch gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
Die Pflichtverletzung sei als gewichtig einzuschätzen. Die Unterschrift des Arztes auf einem Rezept sei kein bloß formeller Vorgang, sondern diene dem Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit der Versicherten.
Auch die vom Arzt eingelegte Sprungrevision blieb ohne Erfolg. Eine Sprungrevision ist eine Form des Rechtsmittels, die es ermöglicht, direkt von einem erstinstanzlichen Urteil (z. B. hier vom Sozialgericht) zum letztinstanzlichen Gericht (z. B. zum Bundessozialgericht) zu gehen, ohne den Zwischenschritt der Berufung zu nutzen.
Das sagt das Gericht
Der Regress war zulässig. Der Arzt hat die für Vertragsärzte bestehende Pflicht zur persönlichen Leistungserbringung verletzt. Die persönliche Unterschrift des Arztes ist wesentlicher Bestandteil der Gültigkeit einer Verordnung. Nur mit einem Unterschriftenstempel versehene Verordnungen können diese hohen Qualitätsanforderungen und die Gewähr für die Richtigkeit und vor allem Sicherheit der Auswahl des verordneten Arzneimittels nicht erfüllen.
Der Arzt hat diese Pflichtverletzung auch verschuldet, da er die Regularien der persönlichen Unterzeichnung jeder Art ärztlicher Verordnungen kennen muss und diese nicht eigenmächtig ändern darf.
Infolge dieser Pflichtverletzungen ist der Krankenkasse auch ein Schaden entstanden. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Verordnungen nicht eingelöst worden sind oder Apotheken sie zurückgewiesen hätten. Auf den Einwand des Arztes, dass die Verordnungen immer medizinisch indiziert gewesen seien, kommt es nicht an.
Entgegen seiner Ansicht verstößt die Festsetzung des Regresses weder gegen den Grundsatz von Treu und Glauben noch ist sie unverhältnismäßig. Denn der Regress entspricht der Summe der in 14 aufeinanderfolgenden Quartalen unrichtig ausgestellten Sprechstundenbedarfsverordnungen.
Der Rat liegt auf der Hand: Unterschreiben Sie Ihre Rezepte ausnahmslos per qualifizierter elektronischer Signatur (QES) oder händisch.
Haben Sie Fragen zu Regressen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen oder Plausibilitätsprüfungen, wenden Sie sich an unsere Praxisberatung. Unsere Praxisinfo „Wirtschaftlichkeitsprüfungen“ gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie solche Prüfungen ablaufen und worauf es dabei ankommt. Weitere Inhalte zum Thema:
- Regress vermeiden
- Die häufigsten Fragen zu Sprechstundenbedarf
- Plausibilitätsprüfung steht an? So widersprechen Sie als Arzt
- Regress: Selten bedrohlich, aber lästig
Besuchen Sie auch unser Webinar „Wirtschaftlichkeitsprüfung: Warum wird wie geprüft?“ am 5. November.
Gilt eine nur vorgelegte Kündigung als „zugegangen“?
Eine schriftliche Kündigung geht einem Arbeitnehmer zu, wenn sie vor ihm auf den Tisch gelegt wird, sodass er in das Dokument Einsicht nehmen und hierüber verfügen kann. Auf die tatsächliche Kenntnisnahme (also ob der Betroffene die Kündigung auch liest) kommt es nicht an. Das hat das Hessische Landesarbeitsgericht am 30.05.2025 (Az.: 10 GLa 337/25) entschieden.
Auch wahrt eine allgemeine Feststellungsklage grundsätzlich nicht die Dreiwochenfrist des § 4 KSchG. In dieser Frist muss eine Kündigungsschutzklage erhoben werden, wenn Streit darüber besteht, ob bei einer Kündigung das Schriftformgebot nach § 623 BGB gewahrt ist.
„Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.“
So kam es zur Entscheidung
Eine Angestellte war seit Ende 2023 in einem Kleinbetrieb im Sinne von § 23 Abs. 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) tätig, also in einem Betrieb, der unter 10 Mitarbeitende beschäftigt. Die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist betrug 3 Monate zum Monatsende. Die Angestellte, die mit einem Vorstandsmitglied, Herrn A, ein intimes Verhältnis hatte, warf ihm Anfang Februar 2024 in einer an den Vorstand gerichteten E-Mail vor, in der Silvesternacht ohne ihr Einverständnis sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu haben.
Am 26.04.2024 besprachen sich die Angestellte, Herr A und eine Personalsachbearbeiterin in einem von der Angestellten als Büro genutzten Besprechungsraum. Herr A teilte der Angestellten mit, das Arbeitsverhältnis kündigen zu wollen. Er verließ kurz den Raum und kehrte mit einem Briefumschlag zurück, den er mit den Worten „der Form halber“ auf den Besprechungstisch legte. Der Briefumschlag enthielt ein fristgemäßes Kündigungsschreiben.
Die Angestellte meinte, das Schreiben sei ihr nur kurz vorgelegt, möglicherweise sofort wieder entfernt und jedenfalls nicht ihr eindeutig überlassen worden. Daher sei das Schreiben nicht zugegangen. Am letzten Tag der dreiwöchigen Klagefrist des § 4 KSchG legte sie beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main Klage ein. Ihr Antrag war festzustellen, dass ihr Arbeitsverhältnis über den 31.07.2024 hinaus fortbesteht. Einen konkret gegen die Kündigung vom 26.04.2024 gerichteten „punktuellen“ Klageantrag stellte sie in diesem Verfahren nicht, auch nicht nach einem entsprechenden Hinweis des Gerichts.
Das Arbeitsgericht wies die Klage ab, da es meinte, die Angestellte habe die Klagefrist versäumt, weshalb die Kündigung gemäß § 7 KSchG als wirksam gelte. Das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG) wies die Berufung zurück.
Das sagt das Gericht
Aufgrund des Inhalts der vorausgegangenen Besprechung musste der Angestellten klar sein, dass es um eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses und damit um ein Kündigungsschreiben ging. Der Vorstand hat den Briefumschlag auf den Tisch gelegt mit der Bemerkung „der Form halber“. Auch dies war ein deutlicher Hinweis auf ein Kündigungsschreiben, welches nach § 623 BGB der Schriftform bedarf.
Die Angestellte besaß zwar kein eigenes, fest zugewiesenes Büro. Sie hatte sich am Tag der Besprechung jedoch den Besprechungsraum zum Arbeiten ausgesucht. Damit ist ihr die Kündigung rechtswirksam zugestellt worden. Auf ihre Kenntnisnahme des Schreibens kam es rechtlich nicht an.
Da der Angestellten das Schreiben in schriftlicher Form zugegangen ist, hätte sie innerhalb der Dreiwochenfrist des § 4 KSchG eine punktuelle Kündigungsschutzklage erheben müssen. Stattdessen hat sie eine allgemeine Feststellungsklage erhoben, bei der allerdings die Einschränkung vorgenommen wurde, dass das Arbeitsverhältnis über den 31.07.2024 hinaus fortbesteht. Innerhalb der ersten Instanz hat sie keine Umstellung auf eine punktuelle Kündigungsschutzklage vorgenommen.
Damit hat die Angestellte die Dreiwochenfrist nicht eingehalten und die Kündigung ist wirksam.
Besuchen Sie unser Webinar „Die Big Five des Arbeitsrechts“am 1. Oktober. Darin vermitteln wir Ihnen das wichtigste Arbeitsrecht-Wissen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer rund um Kündigung, Abmahnung und Krankheit.
Übrigens: Ob eine Kündigung ohne Grund zulässig ist, entscheidet auch die Praxisgröße.
Ein Kleinbetrieb liegt vor, wenn der Arbeitgeber regelmäßig maximal 10 Mitarbeitende beschäftigt. Die Anzahl der im Betrieb Beschäftigen orientiert sich an der Anzahl der wöchentlich vereinbarten Arbeitsstunden der Arbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte – dazu zählen auch Reinigungskräfte und Minijobber – werden nur anteilig zugerechnet.
- Ein Teilzeitbeschäftigter mit max. 20 h / Woche zählt als 0,5 Mitarbeiter
- Ein Teilzeitbeschäftigter mit über 20-30 h / Woche zählt als 0,75 Mitarbeiter
- Ein Teilzeitbeschäftigter mit über 30-40 h / Woche zählt als 1 Mitarbeiter
Auszubildende zählen nicht mit.
Sie haben eigene Fragen zu Recht und Pflicht rund um die Anstellung? Dann kontaktieren Sie unsere Rechtsberatung. Mehr rund um die Anstellung und wichtige Fristen finden Sie hier:
Ist Umkleiden bezahlte Arbeitszeit – auch bei Urlaub und AU?
Das An- und Ausziehen von Kleidung an sich ist Privatsache und damit grundsätzlich keine Arbeitszeit. Sie ist also nicht nach § 611a BGB zu vergüten. Die Umkleidezeit gilt nach der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte jedoch dann als bezahlte Arbeitszeit, wenn das Umziehen der „Befriedigung eines fremden Bedürfnisses“ dient und nicht zugleich ein eigenes Bedürfnis erfüllt. Diese sperrige Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn Sie Ihre Mitarbeiter anweisen, bestimmte Praxiskleidung bei der Arbeit zu tragen.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 14.05.2025 (Az.: 5 AZR 215/24) nun zusätzlich entschieden, dass die Zeit für das An- und Ablegen von Dienstkleidung auch bei Abwesenheit durch Krankheit oder Urlaub auf dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden muss.
So kam es zur Entscheidung
Ein Rettungssanitäter war verpflichtet, für seine Tätigkeit spezielle Schutzkleidung an- und abzulegen. Gemäß dem auf sein Arbeitsverhältnis anwendbaren Manteltarifvertrag (MTV) erhielt er dafür auf seinem Arbeitszeitkonto eine pauschale Zeitgutschrift von 12 Minuten pro geleisteter Schicht. Diese Umkleidezeiten gelten tarifvertraglich als Vollarbeit.
Sein Arbeitgeber hatte diese Gutschrift nur bei tatsächlich geleisteter Arbeit gewährt – aber nicht, wenn der Sanitäter wegen Krankheit oder Urlaub abwesend war.
Der Kläger hielt das für tarifvertragswidrig und verlangte die Gutschrift von insgesamt 10,4 Stunden für vergangene Krankheits- und Urlaubszeiten. Seine Klage war erfolgreich.
Das sagt das Gericht
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Kläger die geforderten 10,4 Stunden (5,8 Stunden für krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit und 4,6 Stunden für Urlaubszeiten) auf seinem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben.
Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) und dem MTV hat der Arbeitnehmer Anspruch auf die volle Vergütung, die er erhalten hätte, wenn er nicht arbeitsunfähig gewesen wäre. Zeitgutschriften auf einem Arbeitszeitkonto sind eine Form von Entgelt. Da das vorgeschriebene Umkleiden im Betrieb ausschließlich fremdnützig ist, handelt es sich um vergütungspflichtige Arbeit.
Gemäß Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) und MTV muss der Arbeitgeber grundsätzlich alle infolge des Urlaubs ausfallenden Arbeitsstunden vergüten. Das Urlaubsentgelt darf, auch aus Gründen des Unionsrechts, nicht geringer sein als das gewöhnliche Entgelt für die Arbeitsleistung. Die Zeitgutschrift muss daher Bestandteil der Urlaubsvergütung sein, um „wertgleich" mit dem Entgelt für geleistete Arbeit zu sein.
Die Gutschrift von 12 Minuten gehört zum normalen Lohn, den der Sanitäter für seine Arbeit bekommt. Ist er abwesend und erhält diese Gutschrift nicht, bekäme er somit weniger Lohn. Weil diese 12 Minuten regelmäßig und fest zum Gehalt dazugehören, müssen sie auch im Krankheitsfall und im Urlaub weitergezahlt werden.
Im Praxisärzte-Blog erklären wir den wichtigen Unterschied Arbeits- vs. Dienstkleidung. Weitere hilfreiche Informationen rund um Vergütung, Krankheit und Urlaub finden Sie auch hier:
Bei weiteren Fragen zu Vergütung Ihrer Mitarbeitenden oder sonstige Fragen zum Arbeitsrecht ist unsere Rechtsberatung gerne für Sie da. Nutzen Sie bereits unsere juristisch geprüften Musterarbeitsverträge? Hier finden Sie alle Vorlagen zum Download.
Arzt wechselt Status: bedeutsam für den Fortbildungsnachweis?
Ein Statuswechsel vom angestellten zum selbstständigen Vertragsarzt hat keinen Einfluss auf den Fünfjahreszeitraum für Fortbildungsnachweise. Der Statuswechsel führt weder zu einem Neubeginn noch zu einer Unterbrechung, entschied das Bundessozialgericht (BSG) am 27.08.2025 (Az.: B 6 KA 10/24 R).
Das Gericht wies die Klage eines Pneumologen ab. Die Richter hatten zunächst über eine Kürzung von gut 12.000 Euro für das erste Quartal zu entscheiden. Mit Folgequartalen geht es insgesamt um annähernd 50.000 Euro.
So kam es zur Entscheidung
Ein Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie war seit 01.07.2012 in derselben Praxis tätig, zunächst als angestellter Arzt und ab dem 01.01.2015 als Vertragsarzt mit vollem Versorgungsauftrag.
Im Zeitraum vom 01.07.2012 bis 30.06.2017 legte er keine Fortbildungsnachweise vor. Ein entsprechender Nachweis ging erst im August 2018 bei der Kassenärztlichen Vereinigung ein, die das Honorar des Klägers daher für das Quartal 1/2018 um 10 Prozent kürzte.
Der Arzt klagte, doch Klage und Berufung blieben ohne Erfolg.
Zur Begründung hat das Landessozialgericht ausgeführt, der Statuswechsel von einer Anstellung in eine Zulassung führe weder zu einem Neubeginn noch zu einer Unterbrechung des für den Fortbildungsnachweis geltenden Fünfjahreszeitraums. Die Fortbildungspflicht stelle für alle in der vertragsärztlichen Versorgung Tätigen eine Qualitätssicherungsmaßnahme dar. Sie hänge nicht davon ab, in welcher Form die Teilnahme erfolge. Die Kürzung beziehe sich auf den Vertragsarzt selbst und nicht auf den ihn anstellenden Arzt – dies sei jedoch unerheblich.
Der Arzt ging in Revision vor dem Bundessozialgericht. Er rügte die Verletzung von § 95d SGB V sowie seiner Berufsfreiheit aus dem Grundgesetz. Bei einem Wechsel der Rechtspersönlichkeit bedürfe es in jedem Fall einer Sonderregelung für die Honorarkürzung. Die Honorarkürzung sei daher zu Unrecht erfolgt.
Die Richter des BSG waren anderer Meinung.
Das sagt das Gericht
Das Landessozialgericht hat zutreffend entschieden, dass die beklagte KV das Honorar des Arztes kürzen durfte. Denn der Arzt hat die Erfüllung seiner Fortbildungsverpflichtung für den zurückliegenden Fünfjahreszeitraum nicht zeitgerecht nachgewiesen .
Der für den Arzt maßgebliche Fünfjahreszeitraum begann bereits mit Aufnahme seiner Tätigkeit in der vertragsärztlichen Versorgung als angestellter Arzt. Der nahtlose Statuswechsel vom angestellten Arzt zum Vertragsarzt ist von den Regelungen in § 95d Absatz 3 SGB V erfasst. Entgegen der Ansicht des Arztes besteht weder eine Regelungslücke, noch bedarf es einer Sonderregelung.
Die Sanktionierung des fehlenden Nachweises setzt nach dieser Vorschrift lediglich voraus, dass der Arzt bei Ablauf des Fünfjahreszeitraums als Vertragsarzt zugelassen ist und im von der Kürzung betroffenen Quartal Honorar aus der Vergütung vertragsärztlicher Tätigkeit erhält. Welchen rechtlichen Status der Arzt in der vertragsärztlichen Versorgung im Laufe des Fünfjahreszeitraums innehatte, ist nicht entscheidend, solange er ununterbrochen in der vertragsärztlichen Versorgung tätig war.
Bereits der Wortlaut des § 95d Absatz 3 SGB V – „seiner Fortbildungspflicht“ – knüpft an die Person und nicht den Status des Arztes an. Es gibt Regelungen zur Unterbrechung des Fünfjahreszeitraums beim Ruhen der Zulassung sowie zur Möglichkeit, den Fünfjahreszeitraum für angestellte Ärzte auf Antrag zu verlängern, wenn die Beschäftigung länger als drei Monate nicht ausgeübt wird. Aus diesen lässt sich entnehmen, dass sich nur Zeiten der Nichtausübung vertragsärztlicher Tätigkeit auf den Fünfjahreszeitraum auswirken sollen.
Sinn und Zweck der Sanktionierung ist, die Qualität der vertragsärztlichen Versorgung zu sichern. Auch das stützt die Auslegung, dass der Status der Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung während des Fünfjahreszeitraums nicht relevant ist.
Erfahren Sie hier mehr zum Berufsrecht, zur Zulassung und zur Arbeit als angestellter Arzt.
Außerdem empfehlen wir für Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Praxisinfo „angestellter Arzt“ zum kostenlosen Download für Mitglieder im Virchowbund.
Zahlt die Krankenversicherung für eine Bauchdeckenstraffung?
Adipositas-Patienten können trotz einer von der Krankenkasse genehmigten Magenverkleinerungs-Operation in der Regel nicht auch die Kostenübernahme für eine spätere Bauchdeckenstraffung oder eine Brustvergrößerung verlangen. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) in einem am 26.08.2025 veröffentlichen Beschluss (Az.: B 1 KR 15/24 B) entschieden.
So kam es zur Entscheidung
Bei einer Frau wurde wegen einer Adipositas-Erkrankung eine operative Magenverkleinerung durchgeführt. Der von ihrer Krankenkasse genehmigte Eingriff führte zu einem starken Gewichtsverlust und Hautschürzen an der Bauchdecke. Diese wollte die Frau entfernen lassen.
Sie beantragte die Kostenübernahme einer Hautstraffung sowie eine Vergrößerung ihrer Brüste. Die durch die Gewichtsabnahme deformierte Haut stelle eine schwere Belastung für ihr Selbstbild dar und verstärke ihre Depressionen, argumentierte sie.
Die Krankenkasse lehnte die Kostenübernahme ab. Die Frau bezahlte den Eingriff aus eigener Tasche und machte die Aufwendungen in Höhe von 4.284,50 Euro gerichtlich geltend.
Ihre Klage wies aber das Bayerische Landessozialgericht in München ab und ließ keine Revision zum BSG zu. Es habe sich nur um einen kosmetischen Eingriff gehandelt, für den die Versichertengemeinschaft nicht aufkommen müsse. Weder habe es dermatologische noch andere gesundheitliche Gründe für die Bauchdeckenstraffung und die Brustvergrößerung gegeben.
Ohne Erfolg argumentierte die Frau, dass die Krankenkassen bei Brustkrebspatientinnen auch eine Brust-Aufbauplastik bezahlen. Auch die Beschwerde wegen Nichtzulassung der Revision wurde abgewiesen.
Das sagt das Gericht
Für die Bauchdeckenstraffung und Brustvergrößerung habe es nur kosmetische und keine medizinischen Gründe gegeben.
Die Kostenübernahme für eine Aufbauplastik nach einer Brustentfernung bei Krebspatientinnen sei zudem etwas anderes. Dort werde der direkt vor dem Eingriff bestehende Zustand wieder hergestellt. Die Frau wollte aber einen Hautzustand erreichen, der lange vor ihrer Adipositas bestanden habe.
Damit Patienten nicht unerwartet mit Kosten konfrontiert werden, enthält das Bürgerliche Gesetzbuch in § 630C Abs. 3 folgende Regelung:
„Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen Dritten nicht gesichert ist oder ergeben sich nach den Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung in Textform informieren.“
Befolgen Sie diese wirtschaftliche Aufklärungspflicht, sonst besteht die Gefahr, dass Sie das Behandlungshonorar zurückzahlen müssen. Nutzen Sie am besten unsere Vorlagen zum Behandlungsvertrag für Privatversichterte und Behandlungsvertrag für gesetzlich Versicherte.
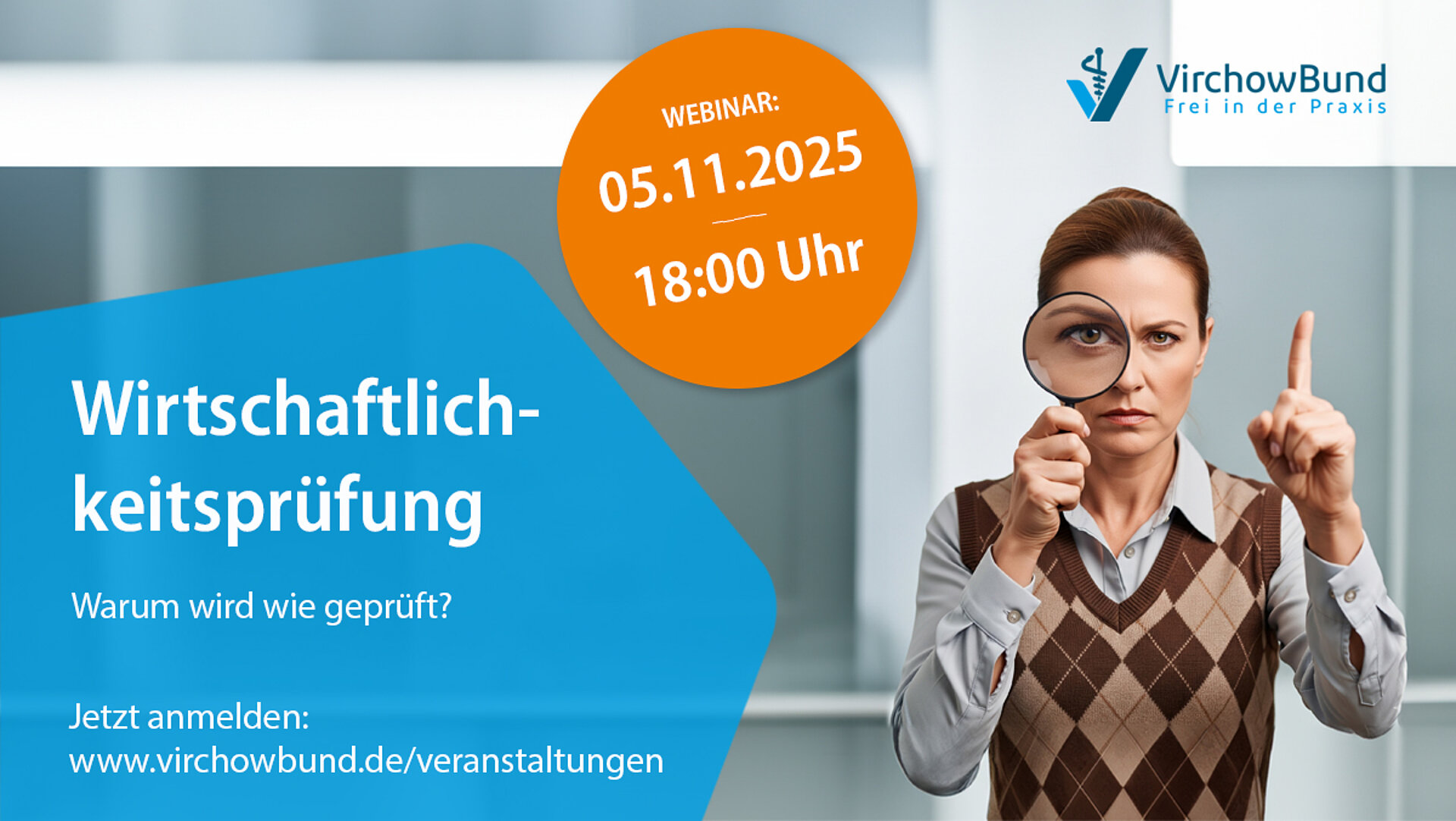




Cookie-Einstellungen
Wir nutzen Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen und unsere Kommunikation mit Ihnen zu verbessern. Wir berücksichtigen Ihre Auswahl und verwenden nur die Daten, für die Sie uns Ihr Einverständnis geben.
Notwendige Cookies
Diese Cookies helfen dabei, unsere Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriffe auf sichere Bereiche ermöglichen. Unsere Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Statistik-Cookies
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Webseite interagieren, indem Informationen anonym gesammelt werden. Mit diesen Informationen können wir unser Angebot laufend verbessern.
Marketing-Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.