
In unserem Rechts-Newsletter sammeln wir für Sie aktuelle Urteile und juristische Fälle. Sie haben noch Fragen zu Arbeitsrecht, Berufsrecht oder einem Vertrag? Ich berate Sie gern.
Müssen Mitarbeitende in der Kündigungsfrist auf Jobsuche gehen?
Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ordentlich und stellt den Arbeitnehmer trotz dessen Beschäftigungsanspruchs von der Arbeit frei, gilt nach einem neuen Urteil: Wenn der Arbeitnehmer vor Ablauf der Kündigungsfrist noch kein anderweitiges Beschäftigungsverhältnis eingeht, unterlässt er in der Regel nicht böswillig im Sinne des § 615 Satz 2 BGB einen anderweitigen Verdienst.
So hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 12.2.2025 (Az.: 5 AZR 127/24) entschieden.
So kam es zur Entscheidung
Ein Mann war seit November 2019 bei einer Firma beschäftigt, zuletzt als Senior Consultant gegen eine monatliche Vergütung von 6.440 Euro brutto. Die Firma kündigte das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 29.3.2023 ordentlich zum 30.6.2023 und stellte den Kläger unter Einbringung von Resturlaub unwiderruflich von der Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung frei.
Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage. Dieser Klage gab das Arbeitsgericht am 29.6.2023 statt. Die von der Firma dagegen eingelegte Berufung hat das Landesarbeitsgericht am 11.7.2024 zurückgewiesen.
Nach Zugang der Kündigung meldete sich der Mann Anfang April 2023 arbeitssuchend und erhielt von der Agentur für Arbeit erstmals Anfang Juli Vermittlungsvorschläge. Die Firma übersandte ihm hingegen schon im Mai und Juni 2023 insgesamt 43 von Jobportalen oder Unternehmen online gestellte Stellenangebote, die nach ihrer Einschätzung für den Mann in Betracht gekommen wären. Auf 7 davon bewarb sich der Mann, allerdings erst ab Ende Juni 2023.
Nachdem die Firma dem Mann für Juni 2023 keine Vergütung mehr zahlte, hat er diese mit der vorliegenden Klage geltend gemacht.
Die Firma hat Klageabweisung beantragt. Sie wendete ein, der Mann sei verpflichtet gewesen, sich während der Freistellung zeitnah auf die Stellenangebote zu bewerben. Weil er dies unterlassen habe, müsse er sich für Juni 2023 einen nach § 615 Satz 2 BGB fiktiven anderweitigen Verdienst in Höhe des bei der Firma bezogenen Gehalts anrechnen lassen.
Das sah das BAG anders.
Das sagt das Gericht
Die Firma befand sich aufgrund der von ihr einseitig erklärten Freistellung des Mannes während der Kündigungsfrist im Annahmeverzug. Sie schuldet dem Mann die vereinbarte Vergütung für die gesamte Dauer der Kündigungsfrist. Nicht erzielten anderweitigen Verdienst muss sich der Mann nicht nach § 615 BGB anrechnen lassen.
Der Nachteil, der durch eine fiktive Anrechnung nicht erworbenen Verdienstes beim Arbeitnehmer eintritt, ist nur gerechtfertigt, wenn dieser wider Treu und Glauben (§ 242 BGB) untätig geblieben ist. Ein solcher Fall lag aber nicht vor.
Unter welchen Bedingungen eine Freistellung eines oder einer Mitarbeitenden nach einer Kündigung zulässig und sinnvoll ist, muss gut überlegt sein. Lassen Sie sich dazu von uns rechtlich beraten.
Wenn Sie kündigen, vergessen Sie auch nicht das Arbeitszeugnis. Oder doch erst einmal abmahnen? Mehr Information:
- Praxisinfo „Kündigung“
- Musterkündigungsschreiben
- Praxisinfo „Arbeitszeugnis“ und Vorlage für das Arbeitszeugnis
- Praxisinfo „Abmahnung“ mit Musterabmahnungsschreiben
- Überblick Arbeitsrecht
Dürfen Ärzte Anweisungen ihrer Vorgesetzten widersprechen?
Grundsätzlich muss ein angestellter Arzt tun, was ihm sein Vorgesetzter (Oberärztin, Chefarzt) sagt. Verstößt eine vom Vorgesetzten angeordnete Behandlungsweise aber gegen medizinisches Basiswissen, weicht die Behandlung auch von der bisherigen Praxis des Krankenhauses ab und bringt dem Patienten überdies ein höheres Risiko ohne gesundheitliche Vorteile, so ist die angestellte Ärztin oder der angestellte Arzt verpflichtet, Einwand zu erheben.
Erhebt er oder sie aber keine Gegenrede, dann haftet er oder sie persönlich für Schäden, die dem Patienten daraus entstehen. So hat das Oberlandesgericht Köln am 27.1.2025 (Az.: 5 U 69/24) entschieden.
So kam es zur Entscheidung
Eine ca. 49-jährige Frau litt unter außergewöhnlich starken Monatsblutungen und einer durch Myome vergrößerten Gebärmutter. Daraufhin vereinbarte sie mit einer Klinik eine ambulante Spiegelung der Gebärmutterinnenseite mittels eines Endoskops sowie eine Abtragung von Polypen bzw. Wucherungen.
Die Patientin wurde von einer Assistenzärztin der Gynäkologie und einer Oberärztin der Gynäkologie in der Klinik operiert. Bei dem Eingriff wurde zunächst der Gebärmutterhals ausgeschabt, dann mehrfach das Endoskop eingeführt. Die Ärztinnen führten dabei ein Gerät ein, das unter Zuführen einer Spüllösung Polypen mit einer Schlinge abtragen kann (monopolares Resektoskop). Als Spülmittel für die Gebärmutter nutzten sie etwa 2,5 Liter destilliertes Wasser. In der Folge kam es u. a. zu einem Leberriss und einem Hirnödem. An dem Hirnödem verstarb die Patientin letztlich.
Hintergrund der Verwendung von destilliertem Wasser war eine Anweisung des Chefarztes an die OP-Schwestern, nur destilliertes Wasser zu verwenden statt Kochsalzlösungen, um eine Korrosion der verwendeten Geräte zu vermeiden.
Nach Ansicht des später vom Gericht eingesetzten Sachverständigen wird schon Medizinstudierenden beigebracht, dass keinesfalls Wasser in den Körper eines Patienten eingebracht werden darf, da dies lebensgefährlich sein kann. Aus Sicht des Sachverständigen war es wohl dieses Wasser, das durch die Wunde in der Gebärmutter in den Blutkreislauf gelangte und das todbringende Ödem verursachte.
Die Assistenzärztin bemerkte zu Beginn der Behandlung, dass die Spüllösung aus Wasser besteht. Ihren Angaben zufolge teilte die Oberärztin ihr mit, dass der Oberarzt Dr. K. die Verwendung des operativen Hysteroskops mit Wasser als unbedenklich angesehen habe. Die Assistenzärztin hat erklärt, sie habe es als ausreichend angesehen, dass der erfahrene Oberarzt keine Bedenken gehabt habe. Aufgrund der Hierarchie habe sie die Aussage des Oberarztes auch nicht in Frage gestellt.
Das Gericht bestätigte die Entscheidung des Landgerichts, mit der die Ärztinnen und die Klinik zur Zahlung u. a. von Schmerzensgeld wegen grob fehlerhafter Behandlung verurteilt wurden.
Das sagt das Gericht
Die Assistenzärztin hatte die Pflicht, fachliche Fragen bezüglich der Spüllösung aufzuwerfen – auch deswegen, weil sie keine direkte Anordnung des erfahrenen Oberarztes Dr. K. erhalten hatte, sondern ihr dessen Auffassung nur von der Oberärztin mitgeteilt worden war.
Dementsprechend hätte gegenüber der Oberärztin eine Remonstration erfolgen können und müssen. Von der Oberärztin wusste sie zudem, dass diese ebenfalls noch keine derartige Operation durchgeführt und deshalb auch keinen (erheblichen) Wissens- oder Erfahrungsvorsprung hatte.
Auch die Oberärztin hat laut dem Gericht einen groben Fehler gemacht: Denn sie, die zum Zeitpunkt der Operation seit einem Monat Oberärztin war, konnte sich bereits nach dem von ihr dargestellten Sachverhalt nicht auf eine für die Behandlungssituation maßgebliche Anweisung des Chefarztes Dr. F. berufen.
Eine direkte Anweisung des Chefarztes bezüglich der Operation der Patientin hat sie selbst nicht behauptet. Sie hat in ihrer Anhörung lediglich angegeben, die OP-Schwestern hätten ihr erklärt, dass das operative Hysteroskop nach einer Absprache zwischen dem Chefarzt und der Leiterin des OP-Pflegepersonals mit destilliertem Wasser benutzt werden sollte; und zwar im Hinblick auf die Vorgabe des Herstellers, keine salzhaltige Lösung zu verwenden, da das Gerät sonst korrodiere.
Die Oberärztin wusste aber ihrer Anhörung zufolge auch, dass in der Klinik bisher für diagnostische Zwecke das operative Hysteroskop nicht verwendet wurde und sonst für Eingriffe wie jenen aus dem Klagefall eine isotonische Lösung als Distensionsmittel benutzt wurde. Die aus zweiter Hand übermittelte Anweisung des Chefarztes konnte sich daher nicht auf die erstmalige Verwendung des monopolaren Resektoskops zu Diagnosezwecken beziehen – sondern nur auf den operativen Einsatz, in der es einen medizinischen Grund für die Verwendung des Resektoskops und das Eingehen höherer Risiken durch die Verwendung einer hypotonen Lösung gab.
Dies konnte die Oberärztin erkennen. Daher war auch sie zu verurteilen.
Erfahren Sie vom Vorwurf eines möglichen Kunstfehlers, informieren Sie in jedem Fall Ihre Haftpflichtversicherung, auch wenn sich der Vorwurf später nicht bestätigen sollte. Wenn Sie die Haftpflichtversicherung nicht informiert haben, können Sie den Versicherungsschutz verlieren.
Erweitern Sie Ihr Wissen rund um Behandlungsfehler:
- Praxisinfo „Behandlungsfehler“ inkl. Checkliste
- Praxisinfo „Besuch vom Staatsanwalt“
- Praxisinfo „Außergerichtliche Streitbelegung“
- Blogbeitrag „Wann Sie als Praxisinhaber für angestellte Ärzte haften“
Mehr zur Arzthaftung erfahren Sie in unserem Überblick über das Arbeitsrecht.
Neue Qualitätsstandards für die Videosprechstunde
Die KBV und der GKV-Spitzenverband haben sich auf weitere Qualitätsstandards für die Videosprechstunde in und außerhalb der Praxisräume geeinigt. Die Vereinbarung trat zum 1. 3.2025 in Kraft.
Die vom Gesetzgeber geforderten Qualitätsstandards sehen unter anderem vor, dass Ärztinnen und Ärzte für Patienten, die sie in der Videosprechstunde versorgen, eine Anschlussbehandlung sicherstellen – zum Beispiel dadurch, dass sie einen zeitnahen Termin in ihrer Praxis anbieten, eine Überweisung zu einer Fachärztin ausstellen oder ihn/sie in ein Krankenhaus einweisen, wenn medizinisch erforderlich.
Terminvermittlungsdienste sind daher ab September verpflichtet, Patienten vorrangig eine Videosprechstunde bei einem Arzt zu vermitteln, deren Praxis sich in räumlicher Nähe zu ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort befindet. Das können je nach Wohnort und Arztdichte Fahrzeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von weit über eine Stunde sein. Dass beispielsweise ein Arzt in Bayern Patienten an der Ostsee oder im Harz per Video behandelt, sollte dagegen eher die Ausnahme sein – jedenfalls sofern näher gelegene Ärztinnen und Ärzte für Videosprechstunden zur Verfügung stehen.
Mit einem Ersteinschätzungsverfahren soll zudem ab September vor der Terminvergabe geprüft werden, ob eine Videosprechstunde überhaupt medizinisch geeignet ist oder ein Patient in eine andere Versorgungsstruktur vermittelt werden muss. Diese Vorgabe gilt nur für die Fälle, bei denen sich Patienten, die einen Arzt per Video konsultieren wollen, an eine Vermittlungsstelle wie den Terminservice 116117 oder einen anderen Anbieter wenden.
Klargestellt ist ferner, dass Vermittlungsportale für Videosprechstunden Termine ausschließlich nach medizinischen Kriterien (nicht zum Beispiel anhand der Kostenträgerschaft oder nach Leistungswünschen) priorisieren dürfen. Das Angebot von Terminen allein zum Zweck einer bestimmten Leistung, z. B. zum Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ist unzulässig.
Mit der Vereinbarung steht jetzt auch fest, unter welchen Bedingungen Ärzte außerhalb ihrer Praxisräume Videosprechstunden anbieten dürfen. Eine Voraussetzung laut Vereinbarung ist ein voll ausgestatteter Telearbeitsplatz in einem geschlossenen Raum. Zudem muss der Arzt auf seine elektronische Behandlungsdokumentation zugreifen können. Die Versorgung der Patienten per Video aus dem Ausland ist nicht gestattet.
Alle Informationen der KBV finden Sie hier. Mehr Information rund um die Videosprechstunde finden Sie auch auf unserem Blog:
- Erfolgreich in der Videosprechstunde: 13 Tipps für Ärztinnen und Ärzte
- Sprechende Medizin nach GOÄ und EBM abrechnen
- GOÄ Nr. 849 abrechnen
- GOP 03230 abrechnen
Oder interessieren Sie sich für Terminvermittlungsdienste? Dann lesen Sie weiter unter:
- Terminbuchung online: Darauf sollten Sie in Ihrer Praxis achten
- Arzttermine online buchen: Anbieter im Vergleich
- Praxisinfo „Terminvermittlung“
- Terminplanung
Wenn Sie sich allgemeiner für eine digitale Arztpraxis interessieren, lesen Sie auf unserer Seite weiter.
Ist Werbung für Behandlungen mit Cannabis wettbewerbswidrig?
Die Werbung für medizinische Cannabisbehandlungen auf einem Internetportal ist wettbewerbswidrig.
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat am 6.3.2025 (6 U 74/24) einem Portalbetreiber u. a. sogenannte Laienwerbung für medizinisches Cannabis und die Durchführung eines Servicevertrages mit verdeckter Provision für die Vermittlung von Patienten untersagt.
So kam es zur Entscheidung
Auf einem Online-Vermittlungsportal können Kunden ihr Interesse an einer ärztlichen Behandlung mit medizinischem Cannabis anmelden. Die Betreiber präsentieren ihnen dort Ärztinnen und Ärzte, mit denen man einen Behandlungstermin vereinbaren kann.
Die Portalbetreiber haben dafür eine Vergütungsregelung mit einem zu hohen prozentualen Anteil des ärztlichen Honorars vorgegeben, und die Dienstleistungen des Portals wurden von mindestens einem ihrer Kooperationsärzte dementsprechend vergütet. Schon das Landgericht ging daher von einer verdeckten Vermittlungsprovision aus.
Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. hält die Werbung und das Verhalten des Portals unter mehreren Aspekten für wettbewerbswidrig. Das Landgericht hat das Portal u. a. verurteilt, es zu unterlassen, bestimmte Werbeaussagen im Zusammenhang mit der medizinischen Cannabis-Behandlung zu tätigen und den Ärzten konkrete Raumnutzungs- und Serviceverträge zur Verfügung zu stellen.
Der Wettbewerbssenat des OLG hat den hiergegen eingelegten wechselseitigen Berufungen teilweise stattgegeben.
Das sagt das Gericht
Zu Recht habe das Landgericht das Portal verpflichtet, die Umsetzung von Raumnutzungs- und Serviceleistungsverträgen mit ihren Kooperationsärzten zu unterlassen, nach deren Vergütungsregelung dem Portalbetreiber ein prozentualer Anteil am ärztlichen Honorar für die Behandlung jedes einzelnen Patienten zusteht. Da dieser Vergütungsanteil zumindest teilweise als Entgelt für die Zuweisung von Patientinnen und Patienten zu den Ärzten über das Portal der Beklagten anzusehen sei, liege ein von dem Portal unterstützter Verstoß gegen ärztliches Berufsrecht vor.
Das Landgericht habe dem Portal auch zu Recht untersagt, für eine ärztliche Behandlung mit medizinischem Cannabis mit dem Slogan zu werben: „Ärztliches Erstgespräch vor Ort oder digital“. Diese Werbung verstoße gegen das Werbeverbot für Fernbehandlungen (§ 9 Satz 1 HWG). Sie sei nicht ausnahmsweise zulässig.
Ein erheblicher Teil des angesprochenen Klientels verstehe die Werbung so, dass die Erstbehandlung mit medizinischem Cannabis alternativ bzw. gleichwertig digital erfolgen könne. Dies sei zum Zeitpunkt der Werbung nach dem seinerzeit geltenden Betäubungsmittelrecht nicht zulässig gewesen. Das Portal habe vor Gericht nicht aufgezeigt, dass ein persönlicher ärztlicher Erstkontakt nach heutigen fachlichen Standards nicht mehr geboten sei.
Schließlich seien – entgegen der Ansicht des Landgerichts – auch Teile der Werbung für eine Behandlung mit medizinischem Cannabis verboten. Zwar liege seit Anfang April 2024 kein Verstoß mehr gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Teile der Werbung verstießen aber gegen das sogenannte Laienwerbeverbot (§ 10 Abs. 1 HWG). Eine „Werbung für Arzneimittel“ stellten nämlich auch Maßnahmen dar, die die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder Verbrauch von unbestimmten Arzneien fördern sollten.
Die Werbung des Portals sei insoweit keine bloße Information zu Cannabis oder reine Unternehmenswerbung, sondern produktbezogene Werbung für verschreibungspflichtige Arzneien. Dass das Portal medizinisches Cannabis dabei nicht selbst anbiete, sei unerheblich. Der Werbende müsse kein unmittelbares Eigeninteresse am Vertrieb des beworbenen Arzneimittels haben.
Das Portal habe ersichtlich die Absicht gehabt, durch seine Werbung (zumindest auch) die Verschreibung und den Absatz von medizinischem Cannabis zu fördern. Dass die Entscheidung, Cannabis zu verschreiben, ausschließlich bei den Kooperationsärzten des Portals liege, stehe der Annahme unzulässiger Arzneimittelwerbung nicht entgegen.
Die Mitgliedstaaten der EU seien grundsätzlich kraft Richtlinie verpflichtet, Öffentlichkeitswerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu verbieten. Außerdem ziele die Werbung in diesem Fall gerade darauf ab, die Nachfrageentscheidung von Verbrauchern nach medizinischem Cannabis zu beeinflussen.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Der Senat hat hinsichtlich des Verstoßes gegen das Laienwerbeverbot die Revision zugelassen. Im Übrigen besteht ggf. die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde.
Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, ob und wie Sie als Ärztin oder Arzt werben können, lesen Sie weiter auf unseren Seiten zu:
Weitere Urteile zu Werbung finden Sie in älteren Rechts-Newslettern wie den Ausgaben 12/24 und 08/24. Bei konkreten Fragen wenden sich an unsere Rechtsberatung.
Meldepflicht bei Infektionen: RKI schaltet Portal für Arztpraxen frei
Das Robert-Koch-Institut hat sein Portal DEMIS jetzt auch für Arztpraxen zur Nutzung und damit zur Meldung von Infektionskrankheiten freigeschaltet. Das Portal können Sie ab sofort nutzen, müssen aber Folgendes beachten:
Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, meldepflichtige Infektionen – wie beispielsweise Keuchhusten, Masern, Mumps, Kinderlähmung, Röteln und Windpocken – den Gesundheitsämtern innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen. Auch entsprechende Verdachts- und Todesfälle müssen gemeldet werden.
Die Meldung muss elektronisch erfolgen. Damit Arztpraxen dieser Pflicht nachkommen, die Behörden die gemeldeten Daten schnell erfassen und falls nötig Schutzmaßnahmen ergreifen können, bietet das RKI das DEMIS-Meldeportal an. Es wurde 2017 gesetzlich im Infektionsschutzgesetz verankert.
Viele Labore und Krankenhäuser nutzen das Portal bereits zur Meldung von nachgewiesenen Krankheitserregern – zudem sind laut RKI alle Gesundheitsämter angeschlossen. Nun sollen auch alle Arztpraxen meldepflichtige Infektionskrankheiten mitteilen. Durch die elektronische Übermittlung sollen die Informationen schneller und vollständiger beim Gesundheitsamt vorliegen und, falls nötig, Infektionsschutzmaßnahmen zeitnah eingeleitet werden können – etwa um weitere Infektionen zu verhindern. Gleichzeitig sollen so der Aufwand für das Absetzen und für die Verarbeitung in den Gesundheitsämtern reduziert und die Übertragung personenbezogener Daten sicherer werden.
Für Arztpraxen stehen laut RKI zur Anbindung an das DEMIS-Meldeportal derzeit primär zwei Wege zur Verfügung: Die Telematikinfrastruktur oder das Internet. Um das DEMIS-Meldeportal zu nutzen, ist eine Authentisierung notwendig, die momentan auf zwei Wegen möglich ist:
- z. B. mittels SMC-B über den sogenannten „gematik Authenticator“. Hierfür muss die Praxis eine aktive Anbindung an die TI, eine SMC-B und am Arbeitsplatz den eingerichteten Authenticator haben.
- mittels „BundID“. Hierfür wird ein Konto bei id.bund.de benötigt. Damit kann der DEMIS-Anmeldeprozess zur Anmeldung nach id.bund.de weitergeleitet werden.
Künftig soll es auch möglich sein, Meldungen (teil)automatisiert über die FHIR-Schnittstelle aus dem jeweils individuell genutzten Praxisverwaltungssystem abzusetzen. Die Anbindung von PVS-Systemen an DEMIS ist derzeit allerdings noch in technischer Vorbereitung. Eine Datenübernahme aus dem PVS in die Formularseiten des DEMIS-Meldeportals ist aber bereits möglich.
Die ausführliche Anleitung zur Nutzung des Portals in der DEMIS-Wissensdatenbank finden Sie hier. Informationen, wie Sie in Ihrer Praxis Infektionen vermeiden, können Sie zum Beispiel hier nachlesen:
Mehr rund um die Praxisorganisation erfahren Sie auf unseren Seiten sowie in unseren praxisnahen Webinaren. Die Aufzeichnung des jüngsten Webinars zum Hygieneplan finden Sie auf YouTube.

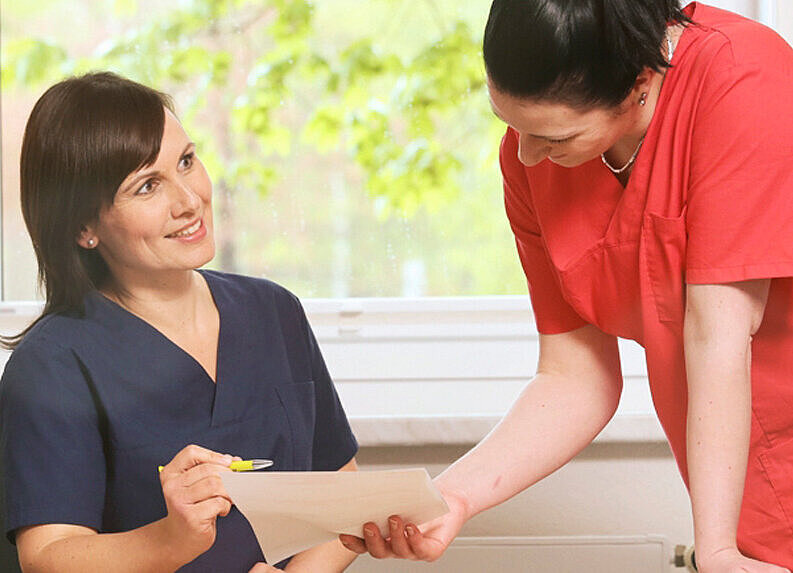

Cookie-Einstellungen
Wir nutzen Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen und unsere Kommunikation mit Ihnen zu verbessern. Wir berücksichtigen Ihre Auswahl und verwenden nur die Daten, für die Sie uns Ihr Einverständnis geben.
Notwendige Cookies
Diese Cookies helfen dabei, unsere Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriffe auf sichere Bereiche ermöglichen. Unsere Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Statistik-Cookies
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Webseite interagieren, indem Informationen anonym gesammelt werden. Mit diesen Informationen können wir unser Angebot laufend verbessern.
Marketing-Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.